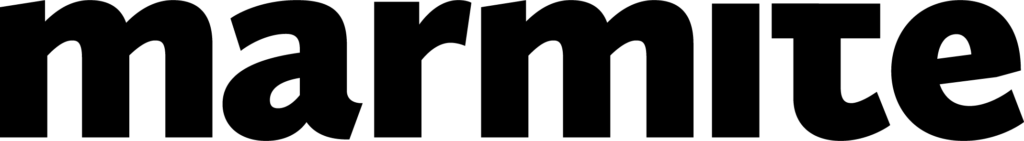Der schöne Schleim

Lust und Ekel liegen dicht beieinander – erst recht, wenn es ums Essen geht. Was dem einen als abscheulich und ungeniessbar gilt, ist für den anderen eine Delikatesse. Ein Blick weit über den Tellerrand hinaus.
Ich weiss noch sehr gut, was wir als Kinder zu unseren Eltern sagten, wenn sie uns nicht unseren Willen liessen: «Ich werde gleich einen Regenwurm essen!» Ich vermute, wir glaubten, wenn wir eine so unappetitliche Drohung ausstiessen, würden unsere Eltern schon nachgeben. Es hat nie geklappt. Und ich kenne auch niemanden, der mal einen Regenwurm gegessen hat. Sie?
Rückblickend hätte ich den Wurm ruhig runterschlucken können. Denn auch später war es – und ist es auch heute noch – für mich selten ein Problem, auf der Suche nach einem neuen köstlichen Geschmack etwas zu essen, das ich noch nie zuvor probiert hatte. Schon als Kind mochte ich Blutwurst, Leber oder Spinat. In Schweden habe ich kürzlich eine Dose Surströmming geöffnet, in Salzlake vergorener Hering. In Galicien kaute ich vor Jahren mal minutenlang auf einem grillierten Schweineohr. Im Norden Thailands kostete ich Kalbsembryo, gebratene Fledermaus und eine extrem bittere dunkelgrüne Grassuppe, die beim Schlachten aus dem zweiten Wiederkäuermagen eines Wasserbüffels entnommen und auf den Strassenmärkten in Eimern verkauft wurde.
In Malaysia ass ich sogar mal einen Hund – was man mir allerdings erst später erzählte. Und im Südwesten Afrikas, wo diese Geschichte über die Lust und den Ekel am Essen beginnen soll, wurde ich wieder und wieder zum Essen farbenfroher, wenn auch etwas stachliger Schmetterlingsraupen eingeladen, die in Angola ein wichtiges Nahrungsmittel sind. Sie riechen nach länger nicht gewaschenen Füssen und werden zu jeder Mahlzeit serviert – erst recht, wenn Gäste aus Europa zu Besuch sind. Raupen zu Nudeln und Bohnen. Raupen mit Zwiebeln und Chili angebraten. Dazu Fuba, ein Brei aus Maismehl. Und zum Frühstück: Raupen auf Toast. Nussig im Geschmack. Der sogenannte Mopane-Wurm wird bis zu zehn Zentimetern lang und zählt zu den grösseren Exemplaren Afrikas. Auffällig rot-schwarz-weiss gemustert, lange Stacheln am ganzen Körper – viele Schmetterlingsraupen schrecken damit Vögel und andere Fressfeinde ab. Den Menschen nicht. In Angola, im benachbarten Namibia und auch in Südafrika werden sie mit Haut und Haaren gegessen, die Eingeweide durch den Darm wie bei einer Tube Zahnpasta herausgedrückt. Getrocknet verspeist man sie als Knabberei oder kocht sie in Salzwasser gar. Zudem werden sie in Salzlauge eingelegt und, eingemacht in Dosen, in den Supermärkten verkauft. Eine andere Art der Konservierung besteht im Trocknen in der Sonne, um die Raupen längere Zeit transportieren zu können. Später werden sie wieder eingeweicht. Lebensmittelchemiker haben die Mopane untersucht. Ernährungsphysiologisch liegen sie nahe beim Thunfisch. Sie besitzen hohe Anteile an mehrfach ungesättigten Fettsäuren. Und sie stellen eine wichtige Eiweissquelle dar. Ihr Proteingehalt ist höher als bei Rindfleisch oder Hühnchen. Und tatsächlich, nach etwa zwei Wochen hatte ich mich an die langen Dinger auf dem Teller gewöhnt. Ich ass sie mit Genuss.
«Are you born a lover or a hater?»
Wer denkt, nur in Asien, Südamerika und Afrika warten ungewohnte Delikatessen, der braucht bloss in Frankreichs Spitzenrestaurants vorbeizuschauen. Dort werden Singvögel, Froschschenkel und Weinbergschnecken serviert. Auch das Noma in Kopenhagen überraschte seine staunenden Gäste immer wieder mit ungewöhnlichen Kreationen wie Klapperschwammpilze mit Schweineblutpüree. René Redzepi und seine Köche fermentierten Heuschrecken zu einer Sauce, die ähnlich schmeckt wie Fischsauce, nur delikater. Sie fingen Ameisen aus Dänemarks Wäldern ein und entdeckten, dass manche den Geschmack von Zitronengras oder Kaffirlimette, andere jedoch Aromen von Koriander oder Pinienkernen besitzen. Und Käsefans jubeln geradezu über den sardischen Schafskäse Casu Marzu, dessen Produktion und Vertrieb aus hygienischen Gründen zeitweise verboten war. Der Käse wird so lange dem Reifeprozess überlassen, bis sich Maden bilden und den Laib vollkommen durchsetzen. Selbst für Anhänger des Käses gilt: Augen zu und durch, denn die quicklebendigen Tierchen springen dem Geniesser auch schon mal unsanft ins Gesicht.

Was wir essen, hängt vor allem davon ab, wo wir leben und wie. Es ist kein Zeichen von Kultur, dass wir hierzulande keine Affen oder Meerschweinchen verspeisen. Seit Jahrtausenden springen Rehe durch unsere Wälder, suhlen sich Schweine auf unseren Höfen, wächst Weizen auf unseren Feldern. Deshalb sind wir mit Wild- und Schweinefleisch vertraut, mögen und finden es in konsumfreundlichen Stücken in der Kühltruhe. Im Regal daneben liegt das Brot.
In Peru aber leben Meerschweinchen. 65 Millionen Tiere werden dort jedes Jahr gegessen. Die Meere rund um die japanischen Inseln werden von Quallen besiedelt. Der Atlantik nördlich der Lofoten ist voller Seespinnen. In Indonesien gibt es Schlangen, in Australien Kängurus. Auf Island geniesst man Hákarl, Haifischfleisch, das für mehrere Monate eingegraben wird und schliesslich an beissendes Ammoniak erinnert. In China, wo ein Sprichwort sagt, dass alles zwischen Himmel und Erde gegessen werden soll, werden Schildkröten und Frösche gezüchtet wie bei uns Schafe und Hühner. Und vielleicht haben Sie ja schon mal von Marmite gehört, der im Jahre 1902 erfundenen vegetarischen Hefe- und Pflanzenextraktpaste, die salzig-würzig schmeckt, reich an Vitamin B ist, aber ausserhalb der Britischen Inseln kaum einer kennt. Die einen lieben den Aufstrich und essen ihn wie Butter auf Brot, den anderen wird schlecht. Und die Kampagne der Pastenmacher bringt die Frage nach Genuss und Ekel auf den Punkt: «Are you born a lover or a hater?»
Was gegessen wird, ist auch eine Frage von Gewohnheit, Geschichte und Lebensumständen. Davon ist auch Daniel Kofahl überzeugt. Der 36-Jährige ist Ernährungssoziologe und im Vorstand der Deutschen Akademie für Kulinaristik. Er beschäftigt sich damit, wie Esskulturen unsere Gesellschaft beeinflussen. 2012 gründete er mit zwei Wissenschaftlern das Büro für Agrarpolitik und Ernährungskultur. Gleich zu Beginn des Interviews kommt er auf die Blutsuppe in Astrid Lindgrens «Michel aus Lönneberga» zu sprechen: «Das Lieblingsessen von allen auf dem Hof in Katthult. Ohne jegliche weitere Kommentierung wird erzählt, wie sich vor einem grossen Fest ausnahmslos alle – von Klein-Ida bis Alfred, dem Knecht – auf die Blutsuppe freuen.» Eines Tages bleibt Michel gar mit dem Kopf in der teuren Schüssel stecken, weil er auch noch den letzten Rest der geliebten Suppe erwischen wollte. «Wenn sie heute jemanden zu Blutsuppe einladen, überlegt er es sich ganz sicher zweimal, ob er kommen soll oder nicht», so Kofahl, dem seit seiner Jugend auch eine Szene aus «Star Trek» in Erinnerung geblieben ist: Auf einem fremden Planeten wird Captain Picard ein Teller mit lebenden Schlangenwürmern vorgesetzt, die beim Volk der Klingonen äusserst beliebt sind. Und überhaupt würden wir uns durch Filme, Bilder und Geschichten einen gewissen Ekel regelrecht antrainieren, glaubt Daniel Kofahl. «Den Ekelfaktor bekommt man aber vor allem anerzogen», sagt er, «kleine Kinder stecken sich ja erst einmal alles in den Mund. Die haben keine Probleme mit Popeln oder Essen, das in den Dreck gefallen ist. Dann aber bekommen sie zu hören, dass dies und das Bäh sei. Und das glauben sie. Und auch die moderne Gesundheitskultur unterstützt die Entstehung von neuen Ekelschwellen. Gerade in Europa hat sich dies sehr stark in Richtung Gruppenidentität entwickelt. Wenn ich mich einer bestimmten Gruppe zugehörig fühle, wie den Vegetariern zum Beispiel, dann ist Fleisch abstossend. Der Ekel ist daher bei uns ganz unterschiedlich verteilt.»

Mit Ekel, so Daniel Kofahl, begegne man in erster Linie dem Fremden – was der Bauer nicht kennt … Und gerade die Erziehung spiele dabei eine gewichtige Rolle. Lässt man Kinder alles probieren und sich spielerisch dem Thema Essen nähern, kann dies Türen öffnen. Was man einem dagegen in der Kindheit aufzwingt, wird einem auch im hohen Alter kaum schmecken. Utz Jeggle, einst Professor für Kulturwissenschaft an der Universität Tübingen und 2009 verstorben, schreibt in seinem bemerkenswerten Essay «Runterschlucken – Ekel und Kultur» auch darüber, wie so manche Eltern ihre Kinder zum Essen erziehen: «Der Geschmack war wegen seiner besonders heftigen Allianz mit der Körperlichkeit bestens dazu geeignet, mit einer Brechstange geöffnet und zugänglich gemacht zu werden. Es erübrigt sich, darauf hinzuweisen, dass Brechen im Deutschen die Zweipoligkeit der Erziehungsschritte ausdrückt; der zerbrochene Willen zerrinnt in der Übelkeit des Erbrochenen. Der Zwang zur Selbstkontrolle ist das Ziel. Der Ekel entspringt einem Akt der Unterwerfung und baut zugleich eine Schranke der Abwehr vor vermeintlich Ungeniessbarem auf. Was Kindsein heisst, was elterliche Gewalt alles vermag, wie Unterwerfung funktioniert, wie Widerstand gebrochen wird und wie er sich im Brechen neu formiert, das demonstriert das soziale Drama des Esszwangs. Ein Geschmacksalbtraum. Und dann sitzt der Ekel vor einer Speise tief. So ist Ekel weniger ein Zeichen der Natürlichkeit des Menschen als vielmehr eine Verbindungslinie zwischen Körper und Kultur.»
Speiseverbote sind ein weitverbreitetes Phänomen. Zu allen Zeiten haben Völker und Kulturen gewisse Nahrungsmittel für unrein erklärt oder aus ideellen Gründen abgelehnt. Von Muslimen und Juden wurde das Schwein mit einem strengen Tabu belegt, von den Hindus das Rind, in Nordamerika und anderswo das Pferd, in Europa unter anderem der Hund. Dass alle genannten Tiere von Angehörigen anderer Kulturen durchaus goutiert werden, zeigt, dass bei der Frage, welche Dinge als gut und bekömmlich gelten, ernährungsphysiologische Gründe oft keine Rolle spielen. Viele Wissenschaftler sind gar der Meinung, dass Speisetabus vor allem eine symbolische Bedeutung haben. Sie dienen also vorrangig dem Zweck, durch die Herstellung kultureller Identität den sozialen Zusammenhalt zu stärken und das eigene Kollektiv gegen andere abzugrenzen. Von dem französischen Verhaltensforscher Claude Lévi-Strauss stammt der berühmte Satz, dass Speisen «nicht nur gut zu essen, sondern vor allem gut zu denken» sein müssen. Sie sollen erst einmal den Geist nähren, bevor sie den leeren Magen füllen. Auf Bauernhöfen war es selbstverständlich, dass das geschlachtete Tier vom Kopf bis zum Schwanz verzehrt wurde. Dies hatte auch mit Moral und Respekt zu tun. Seit Jahren bemühen sich einige Gastronomen und Sterneköche nun wieder um eine Rehabilitierung von vergessenen Delikatessen aus Herz, Lunge, Zunge oder Backen. Doch sie stemmen sich gegen einen Trend, der übermächtig erscheint. Selbst Fettränder am Fleisch werden als eklig empfunden. Das Tier ist zum Filetspender mutiert, dem bloss einige wenige Teile entnommen werden.
In einem französischen Kochbuch von 1739 heisst es: «Die Därme wurden vom Metzger für die Wurstherstellung genommen. Von den Kutteln fand nur das gras double, die fettesten Teile des Rindermagens, Eingang in die Küche. Hirn wurde in einer Zitronenmarinade gereicht. Augen wurden geschmort und mit Essigsauce serviert.» Auch um 1800 war es noch möglich, über den Kalbskopf zu schreiben: «Viele mögen das Auge. Man schneidet es mit der Messerspitze heraus und teilt es in zwei Hälften.» Im 19. Jahrhundert dann wurden die Zeichen, die an Tier erinnerten, immer mehr verheimlicht. Die zunehmende Fähigkeit des Menschen, sich mit einem Tier zu identifizieren, kann die zunehmende Abneigung gegen den bewussten Verzehr von Hirn, Augen und Hoden erklären helfen. Immerhin: In den letzten fünf Jahren berichten auch die Medien begeisterter über die Renaissance der Innereienküche und über unkonventionelle Köche, die mit Hirn-Herz-und-Hoden-Happenings auf sich aufmerksam machen.

Sushi ist längst ein gutes Beispiel dafür, wie die anfängliche Skepsis vor Unbekanntem umschlagen kann in anerkannten Genuss und wie die Verfeinerung und Ästhetik von Speisen helfen, diese Zweifel zu überwinden. Vor 25 Jahren hätte kaum ein Europäer rohen Fisch angerührt, heute findet man in Berlin mehr Sushi-Läden als Eckkneipen – auch weil man den Fisch nicht mehr als Fisch erkennt. Die erste Sushi-Bar der Schweiz eröffnete 1983 in Zürich. Die ersten Jahre nicht für Schweizer, sondern für in der Schweiz lebende Japaner. Es dauerte noch sehr lange, bis sich die ersten Eidgenossen trauten, diese Inszenierung von rohem Fisch zu essen. Heute gehört Sushi in den kulinarischen Alltag nahezu jeder europäischen Kleinstadt. Genauso ist es mit Kimchi, dem vergorenen, milchsauer eingelegten Scharfgemüse aus Südkorea, das längst in Reykjavik, Paris oder Bern regelmässig auf den Speiseplänen steht (lesen Sie dazu auch die Titelgeschichte in marmite 01/2016).
«Ich esse alles. Und ich bin überglücklich, wenn ich ein Tier oder ein Körperteil finde, das ich noch nicht versucht habe»
Jonathan Gold
Und auch die Globalisierung der Küche wirkt bis tief in den Magen hinein. Daniel Kofahl: «Die Möglichkeit, alles essen zu können, hilft beim Überwinden von Ekel. Wer reist, kommt als leicht verfremdeter Esser zurück, denn er hat vielleicht Dinge probiert, die für ihn absolut neu und ungewöhnlich waren. Das verändert die Sicht der Dinge auf die eigene Esskultur. Aber Lust und Ekel verändern sich auch und unterliegen stark den zeitlichen und globalen Abläufen. Was gestern noch essbar war, kann heute schon als nicht essbar gelten und morgen wiederum als Delikatesse serviert werden.»
Wie man kulinarische Trends – ganz gleich, ob sie genussvoll oder abscheulich sind – setzen kann, demonstriert seit vielen Jahren eindrucksvoll ein Mann namens Jonathan Gold. Der 57-Jährige gilt als einer der einflussreichsten Restaurantkritiker der USA und schreibt regelmässig für die «Los Angeles Times». 500 Restaurants besucht er pro Jahr. Meist bewegt sich der zusehends schwergewichtiger werdende Journalist in seiner Heimatstadt und im endlosen Umland zwischen Strassenständen und Gourmettempeln hin und her. Seine kulinarisch-ethnologischen Expeditionen in die Tiefen der Immigrantenviertel von L.A. haben ihn berühmt gemacht. Kein Tisch ist ihm zu schmierig, keine Ausfallstrasse zu lang oder zu zwielichtig, wenn am Ende ein Erlebnis wartet, das ihm neu ist. Seine wohl wichtigste Eigenschaft: Er kennt keinen Ekel, wie er selber sagt. «Ich esse alles. Und ich bin überglücklich, wenn ich ein Tier oder ein Körperteil finde, das ich noch nicht versucht habe.» Und Jonathan Gold feiert das, was der aktuelle US-Präsident vehement beklagt – dass die USA eine Nation von Einwanderern ist.
Einmal schrieb Gold einige lobende Worte über ein Thai-Restaurant in Hollywood, das neben den amerikanisierten Thai-Gerichten auch eine zweite, unübersetzte Speisekarte führt. «Die Leute kamen in Scharen und bestellten diese wirklich seltsamen Spezialitäten, die ich empfohlen hatte. Fischleber oder Sataw-Bohnen, die wie Müll riechen, der seit Wochen nicht rausgebracht wurde. Und es schmeckte ihnen.»
Zum Abschluss noch eine der unzähligen Dschungelgeschichten des heute 70-jährigen Redmond O’Hanlon. In seinem zweiten Buch «In Trouble Again – A Journey Between the Orinoco and the Amazon» erzählt der britische Anthropologe und Reiseschriftsteller, wie ein Brüllaffe geschossen wurde, der etwa so gross wie ein Cocker Spaniel war: «An diesem Abend, als Pablo den Körper zerlegt und ihn gekocht hatte, reichte Chimo mir ein verdächtig volles Kochgeschirr. Als ich die Suppe auslöffelte, kam der Affenschädel zum Vorschein, dünn bedeckt von seinem roten Fleisch, die Augen noch in ihren Höhlen. ‹Wir haben dir ihn extra gegeben›, sagte Chimo ganz ernst. ‹Das ist eine Ehre in unserem Land. Wenn du die Augen isst, bringt uns das Glück.› Der Schädel starrte mich mit bleckenden Zähnen an. Ich hob ihn hoch, presste die Lippen abwechselnd an jede Augenhöhle und saugte. Die Augen lösten sich von ihren weichen Stielen und glitten meine Kehle hinunter. Chimo setzte seine Schüssel ab, faltete die Hände über seinem Wanst und brüllte vor Lachen. ‹Du Wilder!›, schrie er. ‹Du entsetzlicher nackter Wilder! Meinst du nicht, dass er wie ein Mensch aussieht? Wie konntest du nur so etwas Widerliches tun?›» Und denken Sie an dieser Stelle bitte auch an den Menschen, der als Erster eine Auster schlürfte. Das hatte gewiss nicht nur etwas mit Essen zu tun, es war ein Abenteuer.
Frei nach dem Motto:
«Wenn der Ekel erst überwunden ist, steht dem Genuss nichts mehr im Wege.»
Text: Oliver Lück

Andere Länder, andere Fritten
Urin. Penis. Elefanten.
Wo was gegessen wird, wenn es auf den Tisch kommt:
Nordthailand: Frittierte Feldratte
4 ausgewachsene oder
8 kleine Ratten,
10 bis 15 zerdrückte
Knoblauchzehen,
2 EL Salz, ½ EL Pfeffer:
Die Ratten häuten und ausnehmen. Kopf und Zehen entfernen. Knoblauch, Salz und Pfeffer zu einer Paste mischen und das Fleisch damit einreiben, dann 6 bis 8 Stunden in die Sonne legen, bis es trocken ist. 6 bis 8 Minuten in Pflanzenöl frittieren, bis es hellbraun und knusprig ist. Mit Klebreis, süss-saurer Sauce, Fischsauce oder scharfer Chilipaste und rohen Gemüsen servieren.
Namibia und Kenya: Elefanteneintopf
1 Elefant,
braune Sauce,
Salz und Pfeffer,
2 Kaninchen (optional):
Bitte nur Elefanten verarbeiten, die an Altersschwäche gestorben sind – die Tiere stehen unter Naturschutz! Schneiden Sie den Elefanten in mundgerechte Stücke. Nehmen Sie sich entsprechend Zeit dafür. Die Stücke in einem grossen Topf mit brauner Sauce bedecken. Über einem offenen Feuer 4 Wochen lang bei 240 Grad kochen. Das ergibt etwa 3800 Portionen. Erwarten Sie mehr Gäste, können Sie 2 Kaninchen hinzufügen – aber bitte nur im Notfall, weil die meisten Menschen keinen Hasen im Eintopf mögen.
Indien
Mango/Urin-Lassi
1 Tasse neutraler Joghurt,
2 EL Zucker,
½ Tasse Urin,
½ Tasse Mangofruchtfleisch, Eiswürfel:
Alle Zutaten in einem Mixer gut vermischen und sofort servieren. Anstelle von Mangos können auch andere Früchte verwendet werden.
China: Penissuppe
125 g Penis (Wild, Rind usw.), 1 Tasse Reiswein, 10 bis 12 Tassen Wasser, Kräuter und Gewürze aus der chinesischen Apotheke:
Das Penisfleisch in Reiswein ein paar Minuten einweichen, um den penetranten Geruch zu beseitigen. Mit Salz einreiben, mit heissem Wasser bedecken und 1 bis 2 Minuten kochen. Herausnehmen und schrubben. Dann in kleine Stücke schneiden. Fleisch und Kräuter im Doppeltopf mit Wasser bei starker Hitze 90 bis 120 Minuten kochen. Normalerweise sind mehrere Kräutermixturen erhältlich, wobei die Mischungen den Bedürfnissen des Kunden entsprechen; etwa zur Durchblutung, zum Stehvermögen usw. Erkundigen Sie sich in der Apotheke. Schliesslich das gekochte Fleisch entfernen und die Brühe trinken.
USA, Hawaii: Quallensalat
200 g gesalzene Qualle, 1 grosse Gurke in Streifen geschnitten, 1 EL Erdnussbuttercrème, 1 EL Sojasauce, 1 EL Essig, 1 EL Zucker, 1 TL Sesamöl, 1 Spritzer scharfes Chiliöl:
Die Qualle waschen. 20 Minuten unter fliessendem Wasser spülen, bis sie nicht mehr salzig ist. In Streifen schneiden. 5 Sekunden in kochendem Wasser blanchieren und in kaltem Wasser abschrecken. Abtropfen lassen. Die Gurke auf einem Servierteller anordnen. Die Qualle auf die Gurke geben. Die restlichen Zutaten in einer Schüssel vermischen. Zum Salat servieren.
Alle Rezepte sind entnommen aus: «Strange Food – Skurrile Spezialitäten» von Jerry Hopkins und Michael Freeman.
Könnte dir auch gefallen
Süsse Pracht in Zürichs Altstadt
Mar. 2024
Marc Döhring, der in marmite 6/22 unser Gastgeber war, hat an der Zürcher Schlüsselgasse seinen ersten eigenen Laden eröffnet.
Unsere 6 kulinarischen Lieblinge im Engadin
Mar. 2024
Entdecken Sie sechs verlockenden kulinarischen Geheimnisse des Engadins, die von traditioneller Bäckereikunst bis hin zu exquisiter Pâtisserie reichen.
Ein Tempel für das Beste vom Schwein
Feb. 2024
Wie schafft es ein Restaurant, das nur Schweinefleisch serviert, auf Platz zwölf der inoffiziellen Weltrangliste?
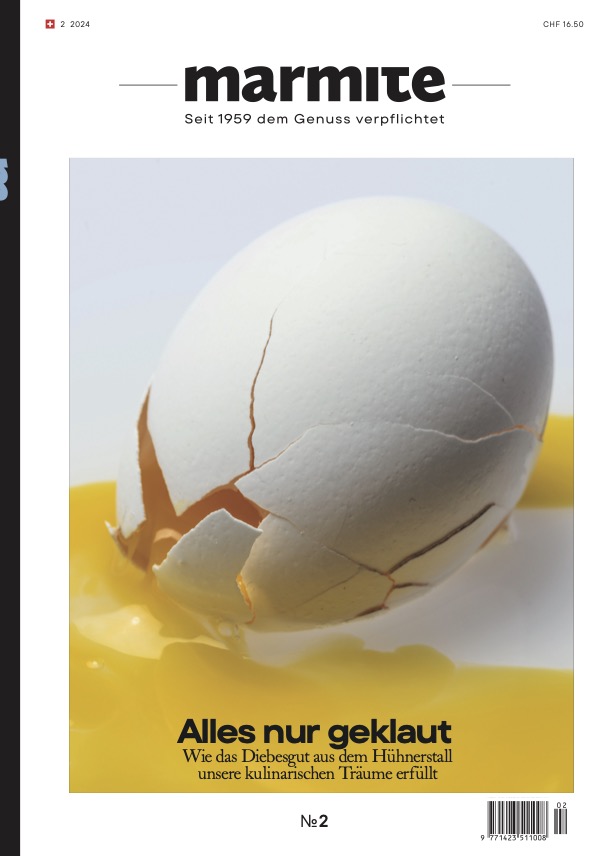

Profis profitieren mit dem Kombiabonnement
Wir bieten Inhalt für Anspruchsvolle. Bestellen Sie noch heute Ihr Jahresabonnement!
Jetzt bestellen